Medien
Ein Speicher voller Sonne
Solarthermiekraftwerke wandeln die Energie der Sonne in elektrische Energie um. Das große Plus: Mit Wärmespeichern liefern sie auch dann Strom, wenn die Sonne nicht scheint. Von einer umweltfreundlichen Technologie, der Experten eine große Zukunft voraussagen.

Hunderttausende Spiegel glitzern in der Wüstensonne. 800 Reihen bilden sie, jeweils hunderte Meter lang. In Ouarzazate im Süden Marokkos entsteht eine Stromfabrik der Superlative: Das Sonnenwärmekraftwerk soll das größte der Welt werden, so groß wie etwa 4.000 Fußballplätze. Seit Inbetriebnahme im Februar 2016 produziert die erste Ausbaustufe Noor I – auf Arabisch „Licht“ – mit einer Nennleistung von 160 Megawatt (MW) Strom. Genug für 350.000 marokkanische Haushalte. Noor I ist erst der Anfang: Das auf insgesamt vier Kraftwerke ausgelegte Vorzeigeprojekt soll bis Ende 2017 eine Kapazität von 500 MW liefern.
Strom aus der Wüste
„Solarwärmekraftwerke konzentrieren Sonnenlicht, um hohe Temperaturen zu erzeugen. So können sie in sonnenreichen Regionen in großen Mengen umweltfreundlichen Strom aus erneuerbarer Quelle liefern“, erklärt Professor Robert Pitz-Paal, Direktor des Instituts für Solarforschung am Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum (DLR). Konzentrierende Solarthermie, beziehungsweise Concentrating Solar Power (CSP), eignet sich am besten für Länder mit hoher Sonnenintensität. Der marokkanische Solarpark liegt perfekt: Die Sonneneinstrahlung erreicht in der Gegend um Ouarzazate eine Intensität von mehr als 2.500 Kilowattstunden (kWh) pro Quadratmeter und Jahr – einer der höchsten Werte weltweit.
Interview mit Professor Pitz-Paal, Direktor des Instituts für Solarforschung am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)
Was ist konzentrierende Solarthermie (Concentrating Solar Power, CSP) und was fasziniert Sie daran?
Fast jeder kennt Photovoltaik oder Windkraft, aber nur wenige konzentrierende Solarthermie. Woran liegt das?
Welche Forschungsschwerpunkte werden gesetzt?
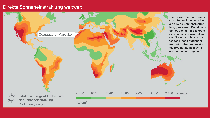

Konzentrierte Sonnenkraft
537.000 computergesteuerte Parabolspiegel richten sich in der Noor-I-Anlage wie Sonnenblumen ständig zur Sonne hin aus. Sie bündeln die Lichtstrahlen der Sonne und wandeln sie in Wärmeenergie um. Über zehn Meter ragen die leicht gebogenen Spiegel in die Höhe. In ihrer Mitte verlaufen Rohrleitungen, in denen ein Thermoöl zirkuliert. Die synthetische Flüssigkeit, die auf bis zu 393 Grad Celsius erhitzt werden kann, wird zum Kraftwerk geleitet, dem Zentrum der gigantischen Spiegelfläche. Dort wird Wasserdampf erzeugt, der die riesige Kraftwerksturbine antreibt. Damit der Strom auch nach Sonnenuntergang zur Verfügung steht, wurden große Wärmespeicher installiert. Dadurch können Solarwärmekraftwerke im erneuerbaren Energiemix einen entscheidenden Vorteil bieten: Strom kann rund um die Uhr genutzt werden.


Volle Leistung auch nachts
Die Wärmespeicher von Noor I bestehen aus zwei riesigen Stahltanks: „Darin befindet sich eine spezielle Salzmischung aus Kalium- und Natriumnitrat, die bei Temperaturen von etwa 240 Grad Celsius flüssig wird“, erklärt Dr. Matthias Hinrichs, Manager Solar Business und New Business Development Inorganics bei BASF. Das Chemieunternehmen konzentriert sich bei den Speichersalzen auf die Herstellung von hochreinen synthetischen Natriumsalzen – schon seit über 90 Jahren. Durch die Abgabe der Wärme aus dem Speicher kann die volle Leistung der CSP-Kraftwerke auch über Nacht aufrechterhalten werden. Für die Salzmischungen in den Speichertanks werden gewaltige Mengen benötigt: Rund 27.000 Tonnen Natriumnitrat produzierte BASF in Ludwigshafen allein für die Anlage in Marokko.


Neue Investitionen und Job-Boom?
Laut der Studie „Solar Thermal Electricity – Global Outlook 2016“ leisten Länder wie Marokko damit einen wichtigen Beitrag, um den Ausstoß von Treibhausgasen zu vermindern: Bereits 2020 könnten die Länder, die im Sonnengürtel der Erde liegen – also zwischen dem 40. nördlichen und 40. südlichen Breitengrad – durch konzentrierende Solarwärme 32 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Aktuell belegen Spanien und die USA in Sachen CSP-Kapazität die Spitzenplätze. Doch andere Länder ziehen nach: China will bis 2020 Solarwärmekraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 10 Gigawatt (GW) in Betrieb nehmen und Saudi-Arabien plant bis 2032 eine CSP-Kapazität von 25 GW. Nach Ansicht der Studie, die von SolarPACES, einem Technologieprogramm der Internationalen Energieagentur (IEA), Greenpeace und dem europäischen Industrieverband Solarthermische Stromerzeugung (ESTELA) in Auftrag gegeben wurde, würde zudem der Einsatz der klimaneutralen Energiequelle in diesen Ländern im selben Jahr für Investitionen in Höhe von 16 Milliarden € sorgen und in Zukunft 70.000 neue Arbeitsplätze schaffen.















